Drei Schwestern
August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
OPER
Drei Schwestern - Peter Eötvös (1944 - 2024)
Три сестры · Oper in drei Sequenzen (1998)
Libretto von Claus H. Henneberg und Peter Eötvös
nach dem Schauspiel Drei Schwestern von Anton Tschechow
Neuinszenierung
In russischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
Irina erträgt es nicht mehr, es bricht aus ihr hervor: „Mein Gott! Wohin ist alles entschwunden? Ich habe alles vergessen.“ Dann, wie unvermittelt: „Niemals werden wir nach Moskau ziehen.“ Weder die Vergangenheit mit ihren Erinnerungen noch die Zukunft mit ihren Hoffnungen bieten noch Halt. Die Zeit erodiert und schrumpft auf die Gegenwart zusammen — und hier herrschen Leere, Unzufriedenheit, Schmerz, Einsamkeit. Ein Zustand, der fast alle Figuren in Peter Eötvös’ Oper Drei Schwestern (1998) — es sind jene aus Anton Tschechows gleichnamigem Drama — heimsucht. Die Reaktionen sind vielfältig: Verdrängung oder Relativierung, Resignation oder Flucht, und natürlich neue Träume, Hoffnungen oder sogar Pläne. Dennoch bleibt eine scheinbar unüberbrückbare Kluft zwischen dem Heute und dem ersehnten Morgen. Warum gelangen diese Menschen nicht nach Moskau, Symbol für ein anderes, besseres, sinnerfüllteres Leben? Welche Hindernisse — innere, äußere — halten sie ab? Es ist eine Frage, in der wir uns stets aufs Neue wiederfinden und die uns Tschechows und damit auch Eötvös‘ Figuren so nahe sein lässt. Sie stellt sich umso schärfer angesichts eines plötzlich um sich greifenden Feuers — einer Katastrophe, die zu konkretem Tun herausfordert, die mit Zerstörung und Leid, mit Tod und dem Bewusstsein konfrontiert, dass das eigene Leben rascher als gedacht enden könnte.
Der ungarische Komponist Peter Eötvös (1944—2024) verlässt in Drei Schwestern — seiner ersten abendfüllenden Oper, der neun weitere folgten — die lineare Handlung von Tschechows Schauspiel. Indem er die Szenen und Textzeilen tiefgreifend umordnete, schuf er drei „Sequenzen“, in denen er jeweils auf eine andere Hauptfigur fokussiert und die Geschehnisse rund um die Geschwister Prosorow und die im Ort stationierten Soldaten aus den unterschiedlichen Blickwinkeln dieser drei Figuren schildert: als subjektive Erinnerungen von Irina und Mascha sowie deren Bruder Andrej (Olga hingegen, die älteste der drei Schwestern, bekam keine eigene Sequenz). Beziehungen, Konflikte und innere Prozesse, die bei Tschechow gleichsam unterschwellig über das ganze Stück hinweg entwickelt werden, führt Eötvös in verdichteter Form, wie unter einem Vergrößerungsglas vor. Dabei arbeitet er in jeder Sequenz eine Dreieckskonstellation heraus. So erhält Irina nacheinander Liebesgeständnisse von dem schwärmerischen Baron Tusenbach und von Stabshauptmann Soljony, der eine dunkle, beunruhigende Faszination auf sie ausübt. Andrej hat mit seinen großen Lebensplänen auch seine Selbstachtung aufgegeben und steht zwischen seinen Schwestern und seiner Gattin Natascha, die ihre Umgebung tyrannisiert und ihren Mann mit dessen Vorgesetzten betrügt. Mascha, frustriert von der Ehe mit dem pedantischen Kulygin, gibt ihrer leidenschaftlichen Liebe zu dem gleichfalls verheirateten Oberstleutnant Werschinin nach.
Nicht alles, was Tschechows Figuren fühlen und denken, findet Ausdruck im gesprochenen Wort — vieles spielt sich in den für den Autor so typischen, im Text vermerkten Pausen ab. Eötvös’ Musik interpretiert auch das Ungesagte, und sie wird Tschechows psychologischer Vielschichtigkeit bewundernswert gerecht. So vermag sie von den ersten, von einem Akkordeon intonierten Takten des Prologs an zu fesseln. Die instrumentale Klangwelt der Oper wird durch zwei Ensembles geprägt: Den 18 Musiker·innen im Graben steht ein 50-köpfiges Orchester hinter der Bühne gegenüber. Die Rollen der drei Schwestern sowie Nataschas hat Eötvös mit Countertenören besetzt. Diese ungewöhnliche Entscheidung erwuchs aus dem Bestreben, durch ein Element von Abstraktion Wahrhaftigkeit jenseits von Gendergrenzen zu erreichen.
Seit der Uraufführung in Lyon konnte sich Drei Schwestern international als eines der faszinierendsten zeitgenössischen Musiktheaterwerke behaupten. Für die Regie der Salzburger Neuproduktion wurde Evgeny Titov verpflichtet: Nach Erfolgen im Sprechtheater macht er seit 2021 mit Operninszenierungen von sich reden, die so sensibel wie scharfsichtig, so berührend wie intensiv sind. Maxime Pascal dirigiert nach der preisgekrönten Produktion von Bohuslav Martinůs The Greek Passion seine zweite szenische Oper bei den Festspielen.
Christian Arseni
Programm und Besetzung
Maxime Pascal - Musikalische Leitung/Dirigent (im Orchestergraben)
Alphonse Cemin - Dirigent (hinter der Bühne)
Evgeny Titov - Regie
Rufus Didwiszus - Bühne
Emma Ryott - Kostüme
Urs Schönebaum - Licht
Paul Jeukendrup - Klangregie
Christian Arseni - Dramaturgie
Besetzung
Dennis Orellana: Irina
Cameron Shahbazi: Mascha
Aryeh Nussbaum Cohen: Olga
Kangmin Justin Kim: Natascha
Mikołaj Trąbka: Tusenbach
Ivan Ludlow: Werschinin
Jacques Imbrailo: Andrej
Andrey Valentiy: Kulygin
Jörg Schneider: Doktor
Jens Larsen: Anfisa
Anthony Robin Schneider: Soljony
Kristofer Lundin: Fedotik
Klangforum Wien Orchestra
Felsenreitschule
Die Idee, die Sommer- bzw. Felsenreitschule in ein Theater zu verwandeln, geht auf Max Reinhardt zurück, der bereits den Umbau der Winterreitschule angeregt hatte In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts brach man an dieser Stelle Konglomerat für den Bau des Domes. Unter Erzbischof Johann Ernst Thun wurden im Jahr 1693 nach Plänen des Barockbaumeisters Johann Bernhard Fischer von Erlach 96 dreigeschossig übereinander gelagerte Arkaden in die Wände des aufgelassenen Steinbruchs geschlagen, um von hier aus Reitvorführungen und Tierkämpfe beobachten zu können.
Als Max Reinhardt 1926 erstmals den Versuch unternahm, mit Goldonis Diener zweier Herren die Felsenreitschule für eine Inszenierung der Salzburger Festspiele zu nutzen, entsprach das Ambiente in idealer Weise der „realistischen“ Charakterkomödie im Volkstheaterstil: Gespielt wurde auf einer „Pawlatschenbühne“, der Boden bestand aus gestampfter Erde, und die Zuschauer saßen auf Holzbänken. Aber auch die 1933 in der Felsenreitschule errichtete Faust-Stadt von Clemens Holzmeister gehört zu den besonders eindrucksvollen Verwandlungen dieses Ortes. Eine erste Opernproduktion fand unter Herbert von Karajan in der Felsenreitschule statt: 1948 gelangte Glucks Orfeo ed Euridice zur Aufführung.
Seit Ende der sechziger Jahre wurden – vor allem nach Plänen des „Festspielarchitekten“ Clemens Holzmeister – einschneidende Umbauarbeiten vorgenommen: Es wurden eine Unterbühne, ein Orchestergraben und eine Scheinwerferrampe errichtet, ein wetterfestes Rolldach eingezogen, das vor Regen und kühlen Sommerabenden schützt, und schließlich ein Zuschauerraum mit Logen und Rampen sowie ein Kulissendepot geschaffen.
Jean-Pierre Ponnelles Zauberflöten-Inszenierung, die zwischen 1978 und 1986 hier allsommerlich gegeben wurde, errang einen legendären Status, aber auch Shakespeares „Römerdramen“ – Julius Caesar, Coriolan sowie Antonius und Cleopatra – in der Regie von Peter Stein und Deborah Warner erwarben sich in den frühen neunziger Jahren internationalen Ruhm.
Bereits im Zuge des Neubaus Haus für Mozart wurde in der Felsenreitschule eine neue Tribüne eingebaut, wodurch sich für das Publikum verbesserte Sichtbedingungen und Akustik ergaben. Seit Juni 2011 verfügt die Felsenreitschule über ein neues Dach.
Neuerungen sind insbesondere:
– die neue Dachkonstruktion mit zwei fixen Randträgern und drei Elementen, gelagert auf fünf Teleskopträgern: Das leicht geneigte, aus drei mobilen Segmentflächen bestehende Pultdach ist auf fünf Teleskoparmen innerhalb von sechs Minuten ein- und ausfahrbar. Hängepunkte auf Teleskopträgern für Bühnentechnik (Kettenzüge), verbesserter Schall- und Wärmeschutz und zwei Beleuchterbrücken optimieren das Bühnengeschehen.
– Neue Sicherheitstechnik inkl. Elektroinstallation, Bühnenlicht, Effektbeleuchtung und Effektbeschallung.
– Das ausgebaute 3. Obergeschoß und der Rohbau des neu gewonnenen 4. Obergeschoßes unter dem Dach der Felsenreitschule – dies ermöglicht letztmalig Raum im Festspielbezirk zu erschließen.
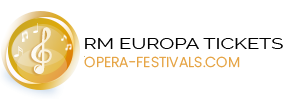
 DE
DE EN
EN IT
IT FR
FR ES
ES RU
RU JP
JP RO
RO
 Sitzplan
Sitzplan 