Macbeth
August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
OPER
Macbeth - Giuseppe Verdi (1813 - 1901)
Melodramma in vier Akten (1847; revidierte Fassung 1865)
Libretto von Francesco Maria Piave, mit Ergänzungen von Andrea Maffei,
nach der Tragödie Macbeth von William Shakespeare
Wiederaufnahme
In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
Handlung
Die Handlung spielt im Schottland des 11. Jahrhunderts. Sie beginnt mit der ersten Prophezeiung der Hexen und endet mit dem Tod Macbeths durch Macduff und der Thronbesteigung Malcolms. Im Hinblick auf den historischen schottischen König entspricht diese Zeitspanne seiner Regierungszeit von 1040 bis 1057. Sie erscheint in der Opernhandlung jedoch auf knapp drei Monate verkürzt, weil nur der Anfang und das Ende seiner Herrschaft thematisiert werden.
Erster Akt
Erstes Bild: Ein Wald
Die Feldherren Macbeth und Banco kehren von einer siegreichen Schlacht zurück. Hexen weissagen, dass Macbeth Than von Cawdor und König, Banco aber Vater von Königen sein werde. Boten verkünden, der König habe Macbeth zum Than von Cawdor erhoben. Beide Feldherren ergreift ein Schauder.
Zweites Bild: Macbeths Schloss
Lady Macbeth liest einen Brief ihres Gatten, in dem dieser die Ereignisse und die Ankunft des Königs mitteilt. Macbeth selbst trifft ein, er ist dem König, der heute bei ihm übernachten will, vorausgeeilt. Die machthungrige Lady kann ihren Mann überreden, den König, der gerade mit seinem Gefolge das Schloss betritt, in der Nacht zu ermorden, um die Weissagung der Hexen zu befördern. Nachdem Macbeth die Tat vollbracht hat, färbt Lady Macbeth die Kleider der Wachen mit Blut, um den Verdacht auf sie zu lenken. Als der Mord entdeckt wird, sind alle entsetzt und verfluchen den Täter.
Zweiter Akt
Erstes Bild: Zimmer in Macbeths Schloss
Macbeth ist König geworden, doch die Prophezeiung, dass sein Thron Bancos Erben zufallen wird, lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Er beschließt, Banco und dessen Sohn Fleanzio ermorden zu lassen.
Zweites Bild: Ein Park in der Nähe des Schlosses
Der Anschlag gelingt nur unvollständig. Während die Mörder Banco töten, kann Fleanzio in der Dunkelheit entkommen.
Drittes Bild: Glänzender Saal
Bancos Tod durch einen Mörder wird dem König gemeldet, der an demselben Abend ein glänzendes Fest gibt. Heuchlerisch bedauert Macbeth Bancos Fehlen. Als er sich an dessen Platz begeben möchte, erscheint ihm der Geist des Toten. Der entsetzte König ist fassungslos und muss durch seine Gattin beruhigt werden. Schaudernd entfernen sich die Gäste.
Dritter Akt
Eine Höhle
Macbeth befragt noch einmal die Hexen nach der Zukunft und seinem Schicksal. Diese warnen ihn vor Macduff, doch der König beruhigt sich schnell, als er erfährt, dass ihn niemand überwinde, den ein Weib geboren hat, und seine Herrschaft erst dann wanke, wenn der Wald von Birnam gegen ihn vorrücke. Lady Macbeth kann den König leicht dazu überreden, Macduff, seine Familie und andere Feinde zu vernichten.
Vierter Akt
Erstes Bild: Öde Grenze zwischen Schottland und England
Macduff ist entkommen und hat sich an der Grenze von Schottland mit Malcolms Truppen vereinigt. Er schwört Macbeth, der seine Kinder töten ließ, bittere Rache. Malcolm befiehlt, dass jeder seiner Soldaten beim Angriff auf Macbeth einen Ast aus dem Wald von Birnam als Tarnung vor sich hertragen solle.
Zweites Bild: Macbeths Schloss
Arzt und Kammerfrau warten spät in der Nacht auf die Königin, die ihr böses Gewissen wahnsinnig werden ließ. Auch an diesem Abend erscheint sie nachtwandelnd und irre redend, gesteht den entsetzten Lauschern ihre Taten und stirbt.
Drittes Bild: Saal in der Burg
Macbeth lässt der Tod seiner Frau gleichgültig, er gerät aber außer sich, als gemeldet wird, dass der Wald von Birnam gegen ihn anrücke.
Viertes Bild: Eine Ebene, von Hügeln und Wäldern umgeben
Auf dem Schlachtfeld begegnet der König Macduff und erfährt, dass dieser nicht geboren, sondern aus dem Mutterleib geschnitten wurde. Macbeths Schicksal erfüllt sich, er fällt im Zweikampf. Macduff und die Krieger grüßen Malcolm, den neuen König.
Programm und Besetzung
Philippe Jordan - Musikalische Leitung
Krzysztof Warlikowski - Regie
Małgorzata Szczęśniak - Bühne und Kostüme
Felice Ross - Licht
Denis Guéguin, Kamil Polak - Video
Claude Bardouil - Choreografie
Christian Longchamp - Dramaturgie
Besetzung
Vladislav Sulimsky: Macbeth
Tareq Nazmi: Banco
Asmik Grigorian: Lady Macbeth
Natalia Gavrilan: Kammerfrau der Lady Macbeth
Charles Castronovo, Joshua Guerrero: Macduff
Davide Tuscano: Malcolm
Ilia Kazakov: Arzt
und andere
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Alan Woodbridge - Choreinstudierung
Angelika Prokopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker
Wiener Philharmoniker
Großes Festspielhaus
Die Pläne für einem Großen Festspielhaus an der Stelle des ehemaligen erzbischöflichen Marstalles gehen in erster Linie auf den Architekten Clemens Holzmeister zurück; an seiner Seite brachte auch Herbert von Karajan Anregungen insbesondere zur Konzeption des Theatersaales in das Bauvorhaben ein. Jede gemachte Anstrengung und teuere Ausgaben wurden nicht gescheut, in die drei Jahrhunderte alte Fassade des ehemaligen Hofstalles und im Mönchsberg als ein Theaterhaus mit einer Opernbühne, deren Anlage und technische Ausstattung noch nach fünfzig Jahren international höchsten Ansprüchen gerecht wird, hinein zu stecken,: Zwischen Herbst 1956 und Frühsommer 1960 wurden 55.000 Kubikmeter Felsen gesprengt, um hierfür den entsprechenden Platz zu schaffen. Der Bau wurde größtenteils aus dem Budget der Bundesregierung finanziert, dementsprechend ist auch die Republik Österreich die Eigentümerin des Großen Festspielhauses.
Die Eröffnung des Großen Festspielhauses erfolgte am 26. Juli 1960 mit einem Festakt und der Aufführung von Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ unter der musikalischen Leitung von Herbert von Karajan. Schon damals erhoben sich Stimmen, die bedauerten, dass die in ihren Dimensionen zweifellos beeindruckende neue Bühne wohl kaum dem für intimere Räume konzipierten Opernschaffen Mozarts gerecht werden könne. Der nahezu quadratische Grundriss des Zuschauerraumes mit ca. 35 Metern Seitenlänge bietet im Parterre wie im Rang ideale akustische und optische Verhältnisse für 2.179 Sitzplätze. Der eiserne Bühnenvorhang mit einem Gewicht von 34 Tonnen ist in seiner Mitte ein Meter dick. Die geschliffenen Stahlplatten schuf Rudolf Hoflehner, den dahinter liegenden Hauptvorhang entwarf Leo Wollner. Die Konzertdekoration wurde 1993 von Richard Peduzzi erneuert. Von der Hofstallgasse aus gewähren fünf Bronzetore mit Türgriffen von Toni Schneider-Manzell dem Publikum Einlass. Die Fassade wird zudem durch eine lateinische Inschrift des Benediktiners Thomas Michels geschmückt: „Sacra camenae domus concitis carmine patet quo nos attonitos numen ad auras ferat.“ (Der Muse heiliges Haus steht Kunstbegeisterten offen, als Entflammte empor trage uns göttliche Macht.)
Bei der Ausgestaltung des Großen Festspielhauses sollte vor allem heimisches Material Verwendung finden: Die Stahlbetonsäulen im Eingangsfoyer wurden mit dem beim Abtragen der Mönchsbergwand gewonnenen Konglomerat verkleidet, der Boden besteht aus Adneter Marmor. Tiefstrahler in der Schrägdecke und Wandschalen aus Muranoglas sorgen für eine gediegene Beleuchtung. Zwei von Wander Bertoni geschaffene Plastiken aus Carraramarmor versinnbildlichen die Musik und das Theater. Die vier kreuzförmigen Großgemälde zum Thema „Dreams with the Wrong Solutions“, die von dem österreichischen Kunstmäzen und Sammler Karlheinz Essl angekauft und den Salzburger Festspielen als Leihgabe zur Verfügung gestellt wurden, stammen von dem New Yorker Maler und Bildhauer Robert Longo (1993).
In dem sich an das Eingangsfoyer anschließenden Pausensaal sind weitgehend die Grundzüge des fürsterzbischöflichen Marstalles erhalten geblieben. Neu ist der Boden aus grünem Serpentin mit Pferdemosaiken von Kurt Fischer. Das Stahlrelief an der Wand hat Rudolf Hoflehner als „Huldigung an Anton von Webern“ gestaltet. Durch das „Fischer-von-Erlach-Portal“ wird der Blick auf die Pferdeschwemme und den 1987 erworbenen Schüttkasten freigegeben. Ein eigener Zugang linkerhand des Pausensaales führt mittels Rolltreppe zur Altstadtgarage.
Die Errichtung einer „Fördererlounge“ im ersten Stock des Großen Festspielhauses wurde von den amerikanischen Kunstmäzenen Donald und Jeanne Kahn finanziert, die später Hauptmäzene der Festspiele wurden. Die Lounge dient seit 1995 als Empfangssaal für Förderer, Sponsoren sowie deren Gäste und bietet ebenso Raum für Pressekonferenzen und verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Festspiele.
Technische Daten:
Bühnenbreite: 100 Meter
Bühnentiefe: 25 Meter
Portalbreite: 30 Meter
Portalhöhe: 9 Meter
Fünf Hubpodien à 18 x 3 Meter; Fahrgeschwindigkeit max. 0.25 m / sec.; Tragfähigkeit jeweils 20 Tonnen
Hydraulische Bühnenmaschinerien (Doppelanlage von ABB)
Schnürboden: 155 Zugeinrichtungen mit einer Tragkraft von jeweils 500 kg, ein Drittel davon hydraulisch angetrieben und elektronisch steuerbar.
Beleuchtung: 825 regelbare Stromkreise mit einer Leistung von je mindestens 5000 Watt; digitales Lichtsteuerpult; 2000 Scheinwerfer im Gerätepark
Elektroakustik: Tonregiepult mit 16 Eingängen, 16 Summenausgängen und 4 Hilfsausgängen; Anschlüsse für Lautsprecher und Mikrophone im gesamten Bühnen- und Zuschauerbereich
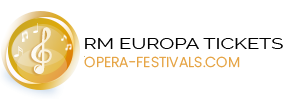
 DE
DE EN
EN IT
IT FR
FR ES
ES RU
RU JP
JP RO
RO
 Sitzplan
Sitzplan 