Solistenkonzert Sokolov
August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Grigory Sokolov zählt zu den bedeutendsten Pianisten der Gegenwart und wird wegen seiner visionären Kraft und seiner uneingeschränkten Hingabe an die Musik bewundert. Seine Interpretationen basieren auf fundierten Repertoirekenntnissen und seine Programme umfassen die gesamte Musikgeschichte von Transkriptionen geistlicher Polyphonie und Werken von Byrd, Couperin, Rameau und Bach über das klassische und romantische Repertoire — besonders Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin und Brahms — bis hin zu Schlüsselwerken des 20. Jahrhunderts.
Grigory Sokolov wurde in Leningrad geboren und nahm mit sieben Jahren sein Studium bei Leah Zelikhman an der Zentralen Musikschule des Leningrader Konservatoriums auf. 1966 machte er Schlagzeilen über die Sowjetunion hinaus, als er mit 16 Jahren und damit jüngster Musiker die Goldmedaille des Internationalen Tschaikowski-Wettbewerbs in Moskau erhielt. In den 1970er-Jahren unternahm er Konzertreisen in die USA und nach Japan. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion trat er in den großen internationalen Konzertsälen und bei den wichtigsten Festivals auf. Als Solist arbeitete er mit Orchestern wie den New Yorker Philharmonikern, dem Concertgebouw-Orchester, dem Philharmonia Orchestra, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und den Münchner Philharmonikern, bevor er sich dazu entschloss, nur noch Solo-Rezitale zu spielen.
Heute gibt er etwa 70 Konzerte pro Spielzeit und widmet sich dabei jeweils einem Programm. Als Pianist verfügt er zudem über umfassende technische Kenntnisse der Instrumente, die er spielt, und erkundet vor jedem Rezital die Möglichkeiten des spezifischen Konzertflügels, um das optimale Klangergebnis zu erzielen.
Er ist seit 2014 Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon. 2015 veröffentlichte er einen Live-Mitschnitt von den Salzburger Festspielen, 2017 erschienen Klavierkonzerte von Mozart und Rachmaninow. Begleitet wird die CD-Aufnahme von Nadia Zhdanovas Dokumentation A Conversation That Never Was. Einer Doppel-CD mit Werken von Beethoven, Brahms und Mozart, folgte 2022 eine Aufnahme aus dem Schloss Esterházy mit Sonaten von Haydn, den Vier Impromptus D 935 von Schubert und einer großzügigen Auswahl an Zugaben.
Programm und Besetzung
Grigory Sokolov - Klavier
Programm
William Byrd
John come kiss me now T 478 (Richard Turbet Catalogue)
The first pavan und The galliard to the first pavan T 487
Fantasia T 455
Alman T 436
The Earl of Salisbury. Pavan und zwei Galliarden T 503
Callino casturame T 441
Pause
Johannes Brahms
Vier Balladen op. 10
Zwei Rhapsodien op. 79
Großes Festspielhaus
Die Pläne für einem Großen Festspielhaus an der Stelle des ehemaligen erzbischöflichen Marstalles gehen in erster Linie auf den Architekten Clemens Holzmeister zurück; an seiner Seite brachte auch Herbert von Karajan Anregungen insbesondere zur Konzeption des Theatersaales in das Bauvorhaben ein. Jede gemachte Anstrengung und teuere Ausgaben wurden nicht gescheut, in die drei Jahrhunderte alte Fassade des ehemaligen Hofstalles und im Mönchsberg als ein Theaterhaus mit einer Opernbühne, deren Anlage und technische Ausstattung noch nach fünfzig Jahren international höchsten Ansprüchen gerecht wird, hinein zu stecken,: Zwischen Herbst 1956 und Frühsommer 1960 wurden 55.000 Kubikmeter Felsen gesprengt, um hierfür den entsprechenden Platz zu schaffen. Der Bau wurde größtenteils aus dem Budget der Bundesregierung finanziert, dementsprechend ist auch die Republik Österreich die Eigentümerin des Großen Festspielhauses.
Die Eröffnung des Großen Festspielhauses erfolgte am 26. Juli 1960 mit einem Festakt und der Aufführung von Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ unter der musikalischen Leitung von Herbert von Karajan. Schon damals erhoben sich Stimmen, die bedauerten, dass die in ihren Dimensionen zweifellos beeindruckende neue Bühne wohl kaum dem für intimere Räume konzipierten Opernschaffen Mozarts gerecht werden könne. Der nahezu quadratische Grundriss des Zuschauerraumes mit ca. 35 Metern Seitenlänge bietet im Parterre wie im Rang ideale akustische und optische Verhältnisse für 2.179 Sitzplätze. Der eiserne Bühnenvorhang mit einem Gewicht von 34 Tonnen ist in seiner Mitte ein Meter dick. Die geschliffenen Stahlplatten schuf Rudolf Hoflehner, den dahinter liegenden Hauptvorhang entwarf Leo Wollner. Die Konzertdekoration wurde 1993 von Richard Peduzzi erneuert. Von der Hofstallgasse aus gewähren fünf Bronzetore mit Türgriffen von Toni Schneider-Manzell dem Publikum Einlass. Die Fassade wird zudem durch eine lateinische Inschrift des Benediktiners Thomas Michels geschmückt: „Sacra camenae domus concitis carmine patet quo nos attonitos numen ad auras ferat.“ (Der Muse heiliges Haus steht Kunstbegeisterten offen, als Entflammte empor trage uns göttliche Macht.)
Bei der Ausgestaltung des Großen Festspielhauses sollte vor allem heimisches Material Verwendung finden: Die Stahlbetonsäulen im Eingangsfoyer wurden mit dem beim Abtragen der Mönchsbergwand gewonnenen Konglomerat verkleidet, der Boden besteht aus Adneter Marmor. Tiefstrahler in der Schrägdecke und Wandschalen aus Muranoglas sorgen für eine gediegene Beleuchtung. Zwei von Wander Bertoni geschaffene Plastiken aus Carraramarmor versinnbildlichen die Musik und das Theater. Die vier kreuzförmigen Großgemälde zum Thema „Dreams with the Wrong Solutions“, die von dem österreichischen Kunstmäzen und Sammler Karlheinz Essl angekauft und den Salzburger Festspielen als Leihgabe zur Verfügung gestellt wurden, stammen von dem New Yorker Maler und Bildhauer Robert Longo (1993).
In dem sich an das Eingangsfoyer anschließenden Pausensaal sind weitgehend die Grundzüge des fürsterzbischöflichen Marstalles erhalten geblieben. Neu ist der Boden aus grünem Serpentin mit Pferdemosaiken von Kurt Fischer. Das Stahlrelief an der Wand hat Rudolf Hoflehner als „Huldigung an Anton von Webern“ gestaltet. Durch das „Fischer-von-Erlach-Portal“ wird der Blick auf die Pferdeschwemme und den 1987 erworbenen Schüttkasten freigegeben. Ein eigener Zugang linkerhand des Pausensaales führt mittels Rolltreppe zur Altstadtgarage.
Die Errichtung einer „Fördererlounge“ im ersten Stock des Großen Festspielhauses wurde von den amerikanischen Kunstmäzenen Donald und Jeanne Kahn finanziert, die später Hauptmäzene der Festspiele wurden. Die Lounge dient seit 1995 als Empfangssaal für Förderer, Sponsoren sowie deren Gäste und bietet ebenso Raum für Pressekonferenzen und verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Festspiele.
Technische Daten:
Bühnenbreite: 100 Meter
Bühnentiefe: 25 Meter
Portalbreite: 30 Meter
Portalhöhe: 9 Meter
Fünf Hubpodien à 18 x 3 Meter; Fahrgeschwindigkeit max. 0.25 m / sec.; Tragfähigkeit jeweils 20 Tonnen
Hydraulische Bühnenmaschinerien (Doppelanlage von ABB)
Schnürboden: 155 Zugeinrichtungen mit einer Tragkraft von jeweils 500 kg, ein Drittel davon hydraulisch angetrieben und elektronisch steuerbar.
Beleuchtung: 825 regelbare Stromkreise mit einer Leistung von je mindestens 5000 Watt; digitales Lichtsteuerpult; 2000 Scheinwerfer im Gerätepark
Elektroakustik: Tonregiepult mit 16 Eingängen, 16 Summenausgängen und 4 Hilfsausgängen; Anschlüsse für Lautsprecher und Mikrophone im gesamten Bühnen- und Zuschauerbereich
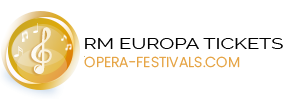
 DE
DE EN
EN IT
IT FR
FR ES
ES RU
RU JP
JP RO
RO
 Sitzplan
Sitzplan 